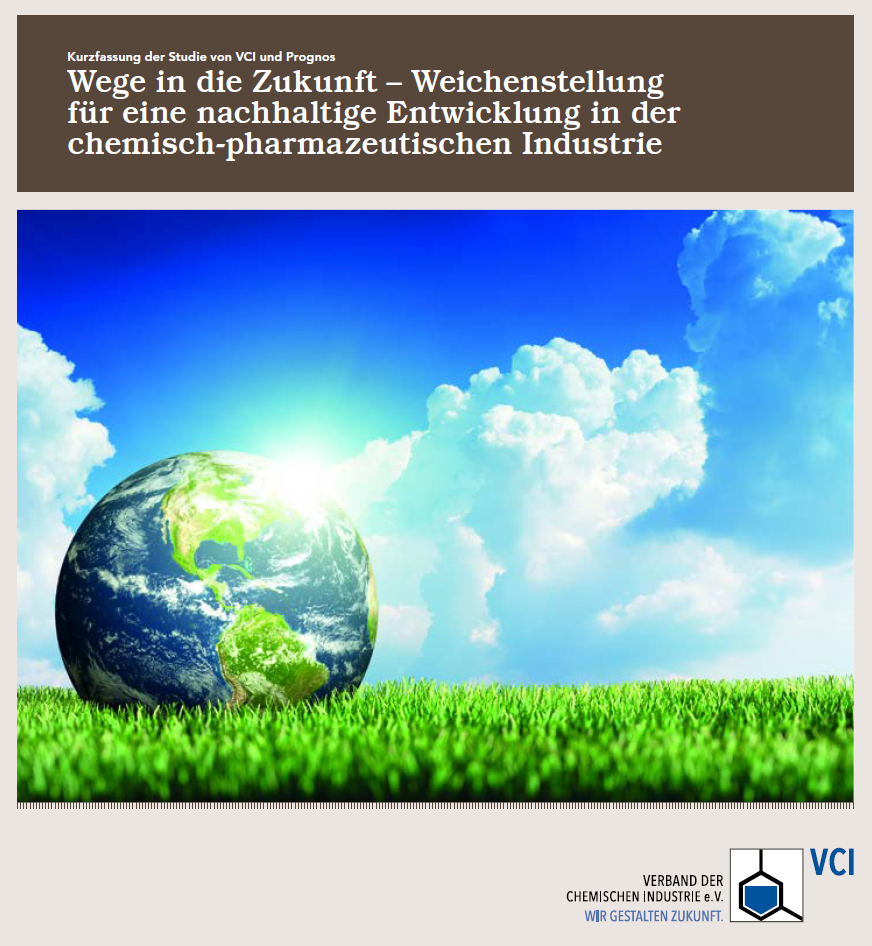ENERGIEPOLITIK
Klimaschutz ist wichtig, aber nicht die einzige Zielgröße
Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Nachhaltiges Handeln bedeutet, dass wir keine Hypothek auf die Zukunft aufnehmen und unseren Nachfahren die Welt nicht in einem schlechteren Zustand hinterlassen als wir sie vorgefunden haben. Deshalb ist Klimaschutz wichtig.
Die chemische Industrie hat dabei in puncto „nachhaltige Produktion“ übrigens bereits erhebliche Anstrengungen unternommen. Im Zeitraum von 1990 – 2016 konnte bei einem Produktionsplus von 67 % gleichzeitig der Energieverbrauch um 17 % und der Ausstoß von Treibhausgasen um 47 % gesenkt werden.
Die Produkte der chemischen Industrie liefern aber vermutlich den viel wichtigeren Beitrag zum Klimaschutz – Silizium für Solarzellen, innovative Batteriematerialien, Kunststoffe für Leichtbauanwendungen, um nur einige Beispiele zu nennen – vielfach dringend benötigte Lösungen für den Klimaschutz!
Aber Klimaschutz ist nicht die einzige Zielgröße. Mit einem Gedankenexperiment wird das klar: Selbstverständlich könnte mit einem Produktions-, Mobilitäts- und Heizverbot relativ schnell auf den Löwenanteilanteil der CO2-Emissionen verzichtet werden. Aber was wären die Auswirkungen? Alle würden im Winter frieren, vielleicht erfrieren. Es gäbe auch kaum noch Arbeitsplätze. Somit könnten sich viele Familien nicht mehr versorgen und es gäbe auch nur noch einen kleinen Staatshaushalt, der deshalb auch nichts kompensieren könnte.
Sicher ist dieses Szenario überzeichnet, aber es wird klar, dass auch der Erhalt der Wirtschaft, der Arbeitsplätze und des guten Auskommens der Familien (und damit des Staates) ein wichtiges Ziel der Nachhaltigkeit sind!
Wenn man sich mit den Wertschöpfungsketten im Land befasst, sieht man, dass auch die energieintensive Industrie im Sinne der Nachhaltigkeit erhalten bleiben muss, denn sie liefert die Rohstoffe für weitere Wertschöpfungsschritte und ist Basis der ganzen Wirtschaft.
Schon jetzt gelingt uns das nicht. Bereits seit dem Jahr 2000 liegt die Reinvestitionsquote der energieintensiven Industrie unterhalb der Abschreibungsquote. Eine schleichende Deindustrialisierung findet also in Deutschland bereits statt. Am Ende dieses Prozesses steht dann nicht mehr der Lösungsbeitrag der Industrie (#Lösungsindustrie) für die anstehenden Herausforderungen sondern der Export von Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und Steueraufkommen. Dem Klima ist damit übrigens nicht geholfen, denn er Effekt wäre nicht das Aus sondern der Export ins Ausland. Dort häufig mit schlechterer Klimabilanz.
Das EEG ist bei Weitem nicht die beste Lösung um das Klima zu schützen
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt die Vergütung des Stroms aus Erneuerbaren Energien Anlagen (Anlage zur Stromerzeugung aus regenerativen Ressourcen) sowie die Finanzierung dieser Vergütung. Erneuerbarer Strom ist – außer Wasserkraft – nicht ohne Subvention rentabel. Strom aus Windkraft und Photovoltaik ist teurer als konventioneller Strom – bei den neuen Anlagen etwas teurer, bei den alten deutlich. Die Differenz zum Börsenpreis wird dem Betreiber der Anlagen aus dem EEG Budget gezahlt und die Kosten, die dabei entstehen werden auf die Stromkunden umgelegt (EEG Umlage).
Das EEG sorgt also im Wesentlichen dafür, dass in Erneuerbare-Energie-Anlagen investiert wird. Darin war es sehr erfolgreich. Es wurden viele dieser Anlagen gebaut. Das Subventionsvolumen beträgt jährlich mittlerweile etwa 25 Mrd. EUR. Die Stromverbraucher zahlen also (netto) 25 Mrd. EUR mehr für den Strom als er wert ist.
Diese Kosten muss man ins Verhältnis setzen zu den damit eingesparten CO2-Mengen im Jahr. Zumindest für die Vergangenheit muss man leider feststellen, dass mit diesen Kosten nicht ein einziges Molekül CO2 weniger emittiert wurde. Denn die Subventionen fokussieren sich ausschließlich auf den ETS-Sektor, also die Stromerzeugung und Industrieanlagen. In diesem Sektor werden – bzw. wurden bisher – die CO2-Emssionen über die europäische Obergrenze (Menge der CO2-Zertifikate) geregelt. In Deutschland vermiedene Emissionen konnten – weil es einzig eine europäische Obergrenze ist – in anderen Ländern mehr emittiert werden.
Wir geben also viel Geld für keine Wirkung aus. Wie hoch könnte die Einsparung sein, wenn man mit diesem Geld gezielt CO2-Emissionen entgegengewirkt hätte? Das EEG soll jetzt abgeschafft werden. Damit fällt die EEG Umlage für Verbraucher weg, aber das beschriebene Problem bleibt eigentlich.
Im ETS-Sektor wird nur europaweit bilanziert – deswegen müssen deutsche Ziele aufgeteilt werden in ETS-Ziele und nicht-ETS-Ziele
Die Ziele im ETS-Sektor sind rein europäische Ziele, die nur kollektiv in Europa erreicht werden können. Egal wie teuer die auktionierten CO2-Zertifikate sind, die absolute Menge ist begrenzt und wird kontinuierlich verringert – dadurch werden die Klimaziele im ETS-Sektor sicher erreicht. Das Zertifikatehandelssystem lenkt zudem CO2-Einsparungen an die Stelle, an der sie am kostengünstigsten realisiert werden können. Dieser europäische, marktbasierte Mechanismus funktioniert am besten ohne planwirtschaftliche Eingriffe und ohne nationale Alleingänge. So würde z.B. der Kohleausstieg in Deutschland durch das ETS-System zwangsweise erfolgen – ganz ohne Kohlekommission. Ein Voranpreschen, um dies ein paar Jahre früher zu schaffen, ist weder nötig noch sinnvoll und vor allem für Deutschland sehr teuer.
Es ist deshalb wichtig, dass man nationale Klimaziele nach ETS-Sektor und Nicht-ETS-Sektor Sektoren – also Bereiche, die nicht unter den Emissionshandel fallen – differenziert! Klimaziele im ETS sind europäisch fixiert, im Nicht-ETS-Sektor obliegt dies den Nationalstaaten. Bei der Festlegung von Zielen darf dies nicht miteinander vermischt werden. Das deutsche Klimaziel muss daher immer aufgeteilt betrachtet werden – in ETS- und Nicht-ETS-Ziele.
Deutschland sollte sich nur um die nicht-ETS-Ziele kümmern – das wäre effizient
Wenn also der CO2-Reduktionspfad im ETS – also für CO2-intenive Industrieprozesse und die Energieerzeugung – eindeutig (EU-weit) vorgegeben wird, ist es am effizientesten, nationale Klimapolitik auf Nicht-ETS-Sektoren zu beschränken. Dies muss die Maxime bei der zukünftigen Energie- und Klimapolitik sein.