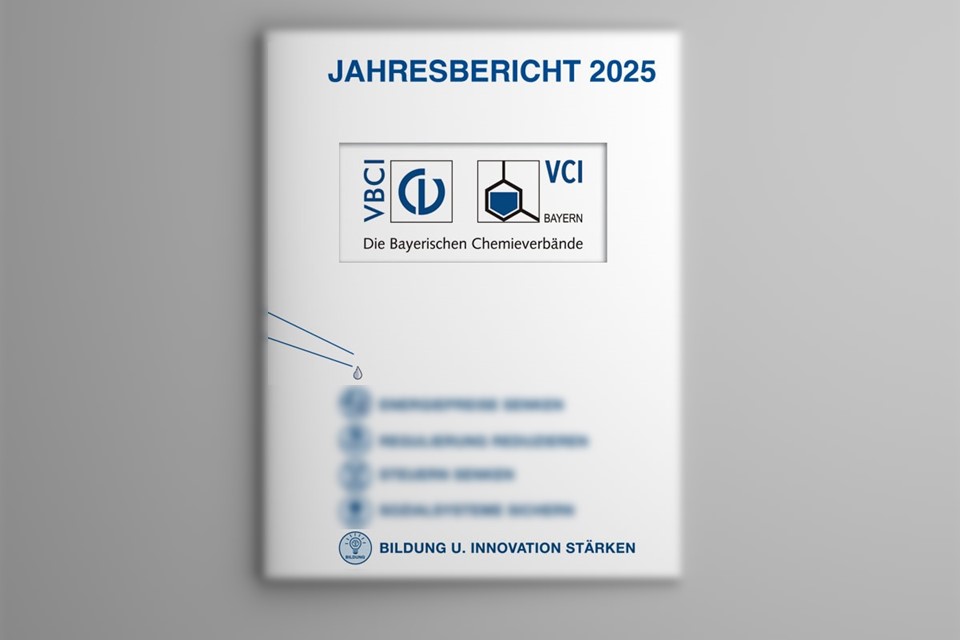Innovationskraft für Wertschöpfung – MINT-Bildung als Schwungrad!
Werden viele standortpolitische Fragen oft kontrovers diskutiert, gibt es bei einer Sache eigentlich fast immer „common ground“: bei der Wichtigkeit von Innovationsfähigkeit.
Innovationen sind der Garant, um mit qualitativ hochwertigen Produkten auf globalen Märkten erfolgreich zu sein.
Innovationen sind Voraussetzung, um technischen Fortschritt überhaupt zu ermöglichen – sei es bei den Klima- und Nachhaltigkeitszielen oder Fortschritten in der Medizin und vielem anderem mehr. Die Chemie- und Pharmaindustrie spielt dabei eine besondere Rolle: Sie steht am Anfang vieler Wertschöpfungsketten und Innovationen anderer Branchen entstehen zumeist an der Grenzfläche zur Chemie.
Chemie und Pharma sind Möglichmacher und Innovationstreiber für fast alle anderen Branchen.

Doch auch, wenn wir derzeit noch eine beachtliche Anzahl Patentanmeldungen verzeichnen können, dürfen wir uns nicht auf unserer durchaus guten Basis ausruhen. Es gilt nun, das bestehende Innovationspotenzial voll auszuschöpfen.
Der VCI hat hierzu in einer Innovationsagenda die wichtigsten Handlungsfelder benannt – von Technologieoffenheit und -neutralität, einer strategischen und planungssicheren Gestaltung von Förderprogrammen, der Stärkung und Vereinfachung von Kooperationen bis hin zum Schutz des geistigen Eigentums. Aber die mitunter wichtigste Zutat sind international wettbewerbsfähige Standortbedingungen, die es ermöglichen, dass Innovationen auch hierzulande in Investitionen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze münden können (siehe o.g. Prioritäten). Denn nur so werden am Ende wieder die Mittel erwirtschaftet, um Forschungs- und Innovationsförderung überhaupt zu ermöglichen.

Die gravierenden Leistungseinbrüche in PISA und TIMSS, der Lehrkräftemangel, die unzureichende Digitalisierung, der Rückgang naturwisenschaftlicher Grundbildung in der Breite wie auch die zunehmende MINT-Fachkräftelücke sind Ausdruck einer Strukturkrise.
Ohne MINT-Kompetenzen fehlen uns nicht nur die Grundlagen für technologischen Fortschritt. Auch die Fähigkeit zu vermitteln, faktenbasiert zu urteilen, technologische Entwicklungen einzuordnen und neue Wege mit Offenheit zu beschreiten, gehen verloren. Unser Innovationsschwungrad verliert mit schwindenden MINT-Kompetenzen an Impulskraft.
Hinzu kommt: Der Bildungskanon in unserem Schulsystem ist weitgehend auf dem Stand des vergangenen Jahrhunderts stehen geblieben. Während die großen Umbrüche in der Wissenschaft innerhalb der Physik noch abgebildet sind, ist die enorme Entwicklung innerhalb der Chemie und zuletzt insbesondere innerhalb der Biochemie noch kaum berücksichtigt. Im neuen G9 teilweise. Aber gerade Chemie und Biochemie werden an Schulen weiterhin zu wenig gelehrt. Hier müssen wir dringend gegensteuern. Von einer systematischen Verankerung frühkindlicher MINT-Bildung bis hin zu einer Modernisierung der Curricula mit durchgängiger naturwissenschaftlicher Grundausbildung in allen Schulformen und Zweigen. Dazu muss digitale Bildung die Regel und nicht der Ausnahmefall sein. Hier braucht auch die Ausbildung von Lehrkräften ein Update – vor allem im Hinblick auf KI, Datenkompetenz und moderne Didaktik. Und – last but not least – dürfen wir im Bildungssystem wie auch in anderen Bereichen nicht völlig von einem Leistungsprinzip abrücken.
Die politische Agenda muss Innovationen wieder in den Vordergrund
rücken und hierfür Bildung – vor allem MINT-Bildung – als strategische
Ressource verstehen.
Fotos und Grafiken: iStock-2160286560 sowie Bayerische Chemieverbände